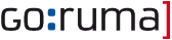Dammtor
Das Dammtor ist eines von drei erhaltenen Stadttoren der Stadtbefestigung der Altstadt. Es wurde um 1300 errichtet und nach dem großen Stadtbrand 1478 in seiner äußeren Gestalt neu errichtet. Das Tor bestand ursprünglich aus einem Innen- und Außentor sowie einem Zwinger mit Zwingermauern, von dem nur noch Fragmente erhalten sind. Der Rundturm des Innenturms ist etwa 32 m hoch. Er ist eine Kombination aus Feldstein- und Backsteinmauerwerk und diente zeitweise als Waffen- und Munitionsdepot sowie als Gefängnis. Der Torbogen wurde 1851 abgerissen, da er den Verkehr behinderte. Das letzte erhaltene Torwächterhaus steht am Rundturm des Tors. Der Name Dammtor stammt von der westlich angrenzenden Vorstadtsiedlung "Damm".
Neumarkttor
Das Neumarkttor entstand im späten 15. Jahrhundert als Teil einer Doppeltoranlage, wobei man vor dem eigentlichen Stadttor noch ein äußeres Tor passieren musste. Der Rundturm, heute als Eierturm bekannt, wurde bereits um 1200 errichtet, etwa 1300 erhöht und um 1480 weiter ausge-baut. Viele Bestandteile des ursprünglichen Tores wie der viereckige Turm und der Torbogen wur-den im 19. und frühen 20. Jahrhundert entfernt; bis heutzutage erhalten sind der Rundturm sowie Teile der ehemaligen Zwingermauern. Im Jahr 1999 wurde das Neumarkttor restauriert, und von 2012 bis 2014 fanden weitere Sanierungsmaßnahmen statt.
Vor dem Tor befindet sich die hölzerne Skulptur einer Frau mit einem Ziegenbock, die auf eine der Legenden hinweist, wie die Stadt Jüterbog zu ihrem Namen kam. Demnach durchquerte eine legendäre Frau namens Jutta als erste mit ihrem Ziegenbock das Tor in die bis dahin namenslose Stadt. Die Stadtobrigkeit, die sich bis dahin auf keinen Namen für die Stadt einigen konnte, machten daraus den Namen Jüterbog
Zinnaer Tor
Das Zinnaer Tor gilt als das schönste der drei erhaltenen Tore. Es liegt im nördlichen Teil der Altstadt. Es war Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und diente ursprünglich als Zugang des rund 4 km entfernten Klosters Zinna. Vom einstigen Doppeltor ist heutzutage nur noch das innere Tor mit zwei Türmen erhalten: ein runder Turm mit Feldsteinfundament von etwa 1300 und ein eckiger, spätgotischer Turm. Der runde Turm wurde später im oberen Teil mit Backstein ausgebaut, der eckige Turm erhielt 1933 ein neues Zeltdach. Der eigentliche Torbogen wurde 1886 entfernt und 1889 in höherer Form wiederhergestellt, das Torwächterhaus existiert nicht mehr.
Mäuseturm
Der Mäuseturm ist ein Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung der Altstadt von Jüterbog,. Er stammt aus dem 15. Jahrhundert und befindet sich an der Stadtmauer in der Straße "Hinter der Mauer". Erwähnenswert ist, dass am Turm ein Aufgang zum Wehrgang nachgestellt wurde. Der Mäuseturm gehört zu den neun Türmen der Stadt, die bis heutzutage erhalten geblieben sind.
Wehrtürme 1 und 2
Die beiden gegenüber liegenden Türme sind der Wehrturm 1 und Wehrturm 2 am Heilig-Geist-Platz. Sie sind durch eine Straße voneinander getrennt. Bei den beiden Türmen handelt es sich um zwei historische Stadtmauertürme, die Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, waren die zur Sicherung und Verteidigung der Stadt errichtet wurden. Mit ihrem Bau wurde um 1300 begonnen. Später im Verlauf des 15. Jahrhundert wurden sie erweitert und ausgebaut.
Rathaus
Das Rathaus der Stadt ist ein Backsteinbau mit Satteldach. Wahrscheinlich war der Bau-beginn einer Urkunde aus dem Jahr 1285 zufolge, als der Magdeburger Erzbischof Erich von Brandenburg (1245-1295) der Stadt eine Fläche am Marktplatz schenkte, um darauf ein Rathaus zu errichten. Vermutlich entstand der Westteil zum Ende des 13. Jahrhunderts aber als Handelshaus. Später wurde ein zuvor freistehender Turm in das Gebäude integriert, der vermutlich im 13. Jahrhundert als Wachtturm entstanden war. Weitere Umbauten und Erweiterung erfolgten im 15. Jahrhundert. Die Gerichtslaube wurde 1477 errichtet und 1493 um ein Obergeschoss erweitert.
Seit dem 14. Jahrhundert war Jüterbog aufgrund seiner Lage zwischen Brandenburg und Sachsen ein beliebter Tagungsort. Dabei spielte das repräsentative Rathaus eine wichtige Rolle als Tagungsort. Zwischen 1355 und 1623 fanden hier mindestens 10 Fürstentreffen statt Auch der Prozess gegen Hans Kohlhase fand hier statt. Besonders erwähnenswert ist der Fürstentag von 1611, als hier u.a. 24 Fürsten zusammen kamen. Der Fürstentag dauerte fast sieben Wochen. Themen waren die Aussöhnung zwischen Brandenburg und Sachsen sowie die jülich-klevische Erbfolge. Man kann sich vorstellen, dass dies zu einer Belebung des Herbergswesen führte und der Stadt erhebliche Einkünfte bescherte.
Im Jahre 1801 stürzte eine Fiale des Ostgiebels herab und verletzte einen Jungen, woraufhin alle Fialen am Rathaus entfernt wurden. 1813 war das Rathaus ein Lazarett für die Verletzten der Schlacht bei Dennewitz. Ab 1816 wurden Räume für die Stadt und das Landgericht abgeteilt. In den Jahren 1849/1850 fanden größere Umbauen statt.. Die barocken Freitreppen wurden entfernt, der Haupteingang wurde in die Gerichtslaube verlegt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Rathaus restauriert Nach 1945 tat sich nur wenig am Rathaus. Da es Bauschäden gab, wurde die Giebel restauriert, der Ostgiebel 1991/1992, der Westgiebel 1992/1993. Im Jahr 1999 wurde das Innere umgebaut.
Nikolaikirche
Die Kirche wurde 1307 erstmalig erwähnt. Die gotische Hallenkirche in ihren heutigen Ausmaßen entstand erst in den folgenden Jhren. Bis 1488 kam der Umgangschor hinzu, 20 Jahre später wurden die Türme vollendet.
Kulturquartier
Die Geschichte des ehemaligen Klosters begann mit der Gründung des Franziskanerklosters und des Kirchenbaus um 1480. Im Jahr 1564 wurde das Kloster an die Stadt übergeben. Nach der Reformation wurde die Klosterkirche eine evangelische Pfarrkirche und das Klostergebäude ein Gymnasium. Im Jahr 1863 fand die Einweihung einer Jungenschule an der Stelle des ehemaligen Nordflügels statt.
Im Jahr 1963, zur Zeit der DDR, fand der letzte Gottesdienst in der Klosterkirche statt. Daraufhin diente der Gebäudekomplex als Baustoff- und Möbellager. 1978 wurde diese Nutzung beendet und 1980 übergab die evangelische Kirchengemeinde den Komplex an den Rat des Kreises Jüterbog. Nach umfangreichen Sanierungen wurde das Gebäude 1985 als Stadt- und Kreisbibliothek, sowie als Theater- und Konzertstätte wieder eröffnet. Damit wurde eine neue Nutzung erreicht, die bis heute anhält. Im Jahr 2001 beschloss die Stadt sämtliche kommunalen Kultureinrichtungen im ehemaligen Kloster unterzubringen. Neu hinzu kamen das Museum, die Stadtinformation und das kulturhistorische Archiv. Das ehemalige Kloster wurde dann schrittweise saniert und 2005 als Kulturquartier der Stadt neueröffnet.
Schmied zu Jüterbog
Dieses Restaurant mit seinem laubumgebenen Biergarten, imponiert mit einer lukrativen Küche. Das Restarant befindet sich neben dem Rathaus am Markt 12.